Kontext: Vermögen - Kapital - Humankapital
Prozess der Teilungen
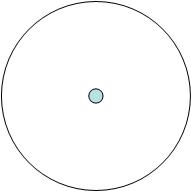 2. Teilung: Das Individuum - Ich und die Anderen
2. Teilung: Das Individuum - Ich und die Anderen
Einführung von Verantwortungshorizonten
Im Mittelpunkt des Verantwortungshorizontes steht die entscheidende Person.
Als Horizont der Verantwortung erweist sich vielfach:
- die Wahrscheinlichkeit, nicht mehr für das Tun und Unterlassen verantwortlich gemacht zu werden oder werden zu können.
- die Grenze der eigenen, formalen Zuständigkeit.
- der Nachweis der Unzuständigkeit aufgrund fehlender formaler Vollmacht.
- die Annahme eigenen Unvermögens.
- die Annahme von Zuständigkeiten Dritter.
- die Annahme eigener Wirkungslosigkeit,
- die Verführung, die Neugierde,
- die Lust oder die Unlust,
- die Routinen und Gewohnheiten,
- die Freiheiten, die man hat, vermutet oder sich herausnimmt.
Als Horizont für die Verantwortung zeigt sich häufig die Verantwortung:
- für sich selbst,
- für Schutzbefohlene, für Angehörige,
- für andere Menschen,
- für Beiträge, für Verhalten, für Unterlassen,
- für Projekte,
- für Organisationen,
- für Orte,
- für das Umfeld,
- für die Umwelt, Nachwelt,
- für die Natur.
Der Horizont der Verantwortung kann sich auch begrenzen auf:
- die Ressourcen,
- die Funktionen,
- die Erfüllung von Pflichten,
- die Wahrnehmung von Rechten,
- die Regelungen,
- die Steuerungen,
- die Entscheidungen,
- die Ergebnisse,
- die Erfolge,
- für Folgen.
Wer die Verantwortung verweigert, wird dennoch sehr oft zur Rechenschaft gezogen, wenn die Verweigerung unrechtens war. Eine bestehende Verantwortung kann nicht begrenzt werden nach dem Motto: "Nach mir die Sintflut".
Die Verantwortung "für die eigene Welt" besteht immer. Sie kann nicht delegiert, verweigert oder umgangen werden.
Manchmal wird auch angenommen, dass dort, wo "kein Richter" ist, es auch keine Verantwortung gebe oder brauche.
Teilungen:
- Horizonte
- Raumhorizonte
- Zeithorizonte
- Ereignishorizonte
- Erlebnishorizonte
- Verantwortungs-horizonte
- Planungshorizonte
- Entwicklungs-horizonte
- Machthorizonte
- Bewegungshorizonte
- Bedarfshorizonte und Bedürfnishorizonte
Mehr dazu:
- 01- Einführung eines Bezugsrahmens
- 02-Einführung des Eigentums
- 03 -Grenzen, Grenzwächter und Brücken
- 04 Verpflichtungen aus dem Eigentum
- 05- Wechsel des Eigentums
